Wie die Politik Medienkompetenz fördern kann
Keine Diskussion über Neue Medien und das Internet kommt ohne den Ruf nach mehr „Medienkompetenz“ aus. Allein, was verbirgt sich hinter dem Begriff und vor allem: wie können wir, Gesellschaft und Politik, dafür Sorge tragen, dass mehr Menschen mehr Medienkompetenz erwerben?
Zu ersterer habe ich schon vor einiger Zeit gebloggt („Was ist Medienkompetenz?“) nun möchte ich mich damit beschäftigen, wie die Politik (mithin die Gesellschaft) darauf Einfluss nehmen kann. Sieht man sich die Programme unterschiedlicher Parteien an, so kommen diese kaum über die – sagen wir es so, ziemlich konsensfähige:) – Aussage hinaus, dass man mehr Medienkompetenz bräuchte und das fördern möchte. Aber wie?
Der Hebel, den ich für die Politik in diesem Zusammenhang sehe, ist der Lehrplan. Hierzu einige Gedanken:
In den Lehrplan sollte aufgenommen werden:
Für das Fach Deutsch:
- Erstellen von vernetzten Hypertexten, d.h., wie man Texte mit Links anreichert und untereinander sinnvoll verknüpft .
- Gestalten eines Textes mit Grafiken, Bildern und Videos, d.h.: wie setzt man einen Text sinnvoll und gestaltet ein Gesamtbild bestehend aus den unterschiedlichsten Medienkomponenten. Vor einigen Jahren waren die meisten Texte, die man zu lesen bekam, kaum bebildert. Das hat sich heute massiv geändert, der Lehrplan muss darauf eingehen.
- Zu den, dem journalistischem Berufsethos entsprechend, möglichst neutral gehaltenen Texten („Mach Dich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer Guten“) treten zunehmend die eigenen Publikationen von Privatleuten und den unterschiedlichsten Interessens- und Lobbygruppen. Medienkompetenz bedeutet, fremde und eigenen Interessen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Für das Fach Sozialkunde:
- Besonderheiten der Computer-vermittelten Kommunikation (z.B. das Fehlen einer non-verbalen Meta-Ebene wie Mimik, Gestik und Sprachmelodie)
- Eigene Interpretation von Medieninhalten (Sensibilisierung für Manipulierbarkeit und Reflexion der eigenen Wahrnehmung)
- Umgang mit unerwünschten Reaktionen in sozialen Netzwerken (on- und offline)
- Einfluss von Massenmedien auf unsere Gesellschaft, insbesondere auf herrschende Machtstrukturen
- Rolle des Bürgers beim eigenständigen Veröffentlichen von Informationen
- Schutz der Rechte Dritter (Urheberrecht und informationelle Selbstbestimmung)
Für das Fach Kunst/Gestalten:
Aquarellmalerei und künstlerisches Gestalten mit Naturmaterialien sind wichtig. Darüber hinaus sollte der Lehrplan aber auch dem realen Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen Rechnung tragen. Diese nutzen zunehmend wie selbstverständlich Computer, um sich künstlerisch auszudrücken. Sei es durch das Bearbeiten von Fotos mit entsprechender Software oder das eigene Gestalten einer Homepage oder eines Printproduktes mit Hilfe des Computers. Ein moderner Lehrplan, der die Förderung von Medienkompetenz im Blick hat, nimmt dies auf:
- Bildbearbeitung am Computer, also die Verfremdung von realen Fotos. Damit einher geht auch ein tieferes Verständnis der Manipulierbarkeit Fremder mit Hilfe von Fotos.
- Gestaltung von Grafiken und Illustrationen am Computer zu eine bestimmten Thema
- Anreicherung von Texten mit Illustrationen und Bildern (siehe auch Lehrplan für das Fach Deutsch)
- Erstellung von Videos und Animationen
Im derzeit gültigen Lehrplan für Bayern findet sich nichts mit Bezug zu moderner Medienkompetenz, also: Lederhose ohne Laptop.
Google oder Goethe, was ist heute wichtiger?
Ich halte Medienkompetenz für ein Querschnittsthema, d.h., in meinen Augen wäre ein eigenständiges Fach „Medienkunde“ oder „Netzpolitik“ oder wie auch immer, der falsche Weg. Ich glaube, es braucht auch nicht den ganz großen Wurf und eine vollumfängliches Umschreiben von Lehrplänen. Aber an der ein oder anderen Stelle sollte es Ergänzungen und Abwägungen geben: Um es provokant auszudrücken: Was ist im Jahr 2010 wichtiger: Google oder Goethe?
Medienkompetenzbildung hört auch nicht mit der Schule auf. Politik muss auch denjenigen Menschen eine Bildungsangebot unterbreiten, die heute 20, 40 oder 90 Jahre alt sind. Diese gehen nicht mehr zur Schule und sind auch mit einem modernen Curriculum nicht mehr zu erreichen. Hierfür muss der Staat Mittel bereit stellen und z.B. entsprechende Kurse, die sich an den oben beschriebenen Lehrplaninhalten orientieren, finanziell fördern. Träger solcher Kurse könnten die Volkshochschulen sein, deren staatlich geförderten Kurse günstiger angeboten werden können.
Es liegt im Interesse des Gesellschaft, mithin des Staates, dass möglichst viele Menschen an diese Gesellschaft aktiv teilhaben. Moderne Kommunikation mit Hilfe des Internets ist ein Weg, bürgerschaftliches Engagement auszuüben. Diese Teilhabe zu fördern ist die Pflicht des Staates.



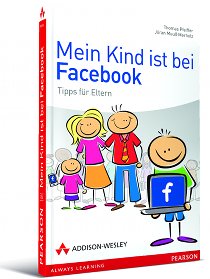


(@joeriben)
Hi, und danke für den schönen Beitrag. Es gibt derzeit eine bundesweite Initiative zum Thema Medienbildung, an der alle Interessierten eingeladen sind, mitzuwirken - von der Online-Unterzeichnung des “Medienpädagogischen Manifests” bis hin zur Diskussion und aktiven Mitgestaltung.
Die Initiative “Keine Bildung ohne Medien” veranstaltet in diesem Zusammenhang einen Kongress im März 2011, zu dem gezielt auch BildungspolitikerInnen eingeladen werden.
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/
(Antworten)
(@huihuppiflupp)
Ein anderes, nah verwandtes Thema: “Wie PolitikerInnen ihre eigene Medienkompetenz fördern können” muss mit dem oben angesprochenem Hand in Hand gehen. Denn nur diejenigen, die über eine eigene Kompetenz verfügen, können entscheiden wie diese angemessen erworben werden kann. Und auch nur dann, wenn PolitikerInnen wissen, wie verschiedene Dinge funktionieren, können sie sinnvolle Gesetze erlassen.
Allerdings sehe ich auch ein Problem: Wenn Kindern in der Schule z.B. Bildbearbeitung beigebracht werden soll, kann das nicht an veralteten Rechnern mit Uralt-Betriebssystemen und -Programmen erfolgen. Dass ich meinerzeit TurboPascal und Windows 3.1 im Informatik-Unterricht hatte, mag vielleicht zu einem Grundverständnis von when-/if-Funktionen beigetragen haben, aber zur Anwendung kommt das dort gelernte Wissen heute nicht mehr.
Die Schulen müssten also mit der entsprechenden Hardware, Software und den zugehörigen Lizenzen ausgestattet werden. Dass das teuer ist, ist keine Frage. Wie es bezahlt werden soll, schon. (Vor allem: Wie sollen sich Kinder aus Haushalten, wo es schon nicht für eigene Schulbücher reicht, zu Hause üben??) Und das ist genau das Grundproblem, das jede Neuerung im Bildungsbereich verhindert: Bildung ist unterfinanziert. Alle reden von Bildung als der Chance für “unsere” Kinder und “unseres Landes”, aber Gelder dafür bereitstellen oder den Haushaltsplan so konzipieren, dass genug in die Bildung und Ausbildung der hier lebenden Menschen investiert wird, schaffen die Worthülsen-Wiederholer irgendwie nicht.
Trotzdem ist es schön zu sehen, dass es Menschen (leider außerhalb der politischen Entscheidungsphäre) gibt, die sich ernsthaft überlegen, wie die Bildung mit der Zeit gehen kann. :)
PS: Ob das jetzt ein Kommentar ist, der Medienkompetenz zeigt? Naja, zur Entschuldigung: Es ist Sonntag “Morgen” und regnerisch und da schweifen die Gedanken rum…
(Antworten)
Klar, eine Hardwareausstattung braucht man. Bildung kostet nun mal Geld.
Bei Lizenzen muss man aber nicht tief in die Tasche greifen.
Linux ist ein hervorragendes Betriebssystem, auf das z.B. auch die Großstadt München umsteigt ( http://www.muenchen.de/limux ) und mit Gimp ( http://www.gimp.org/ ) und Inkscape ( http://inkscape.org/?lang=de ) stehen auch hervorragende Grafikprogramme zur Verfügung, für die man keine Lizenzgebühr entrichten muss.
(Antworten)
(@maennig)
Den Ruf nach Politik und Lehrplänen zur Förderung der Medienkompetenz halte ich für fragwürdig. Da meine kontroversen Gedanken dazu allerdings vom Umfang her etwas voluminöser geworden sind, habe ich sie lieber zuhause veröffentlicht, um deine Gastfreundschaft nicht zu sehr zu strapazieren.
http://maennig.de/2010/09/medienkompetenz-per-lehrplan/
(Antworten)
(@iqberatung)
Ich finde, die Forderungen, wie Medienkompetenz in den einzelnen Fächern gefördert werden kann, sehr passend. Man kann es auch noch auf die übrigen Fächer erweitern, z.B. wie man in Musik Audiodateien erstellt, in Mathe mit Tabellenverarbeitung arbeitet, in Erdkunde z.B. Klimadiagramme erstellt.
Als Basics aber sollte das, was bei Sozialkunde genannt wurde, gelten: u.a.
- Besonderheiten der Computer-vermittelten Kommunikation (z.B. das Fehlen einer non-verbalen Meta-Ebene wie Mimik, Gestik und Sprachmelodie)
Gerade die sozialen Kompetenzen sind bei den Digital Natives in mancherlei Hinsicht nur rudimentär entwickelt, weil eben die Wahrnehmung in einer virtuellen Gruppe nur in Teilbereichen möglich ist. Hier ist ein Training zur Förderung von Teamkompetenz und Umgang mit Konflikten total wichtig.
(Antworten)
(@hdzimmermann)
Vielen Dank für den Beitrag! Genau das ist meine Forderung seit Jahren. Nur durch eine nachhaltige Änderung der Curricula an Schulen - und notabene der Ausbildung von Lehrern - kann die Medienkompetenz gefördert werden. Und womöglich lassen sich die ‘neuen Medien’ auch in vielen weiteren Fächern vernünftig nutzen, z.B. in Geographie oder auch im Fach Wirtschaft. Recherchekompetenz, aber auch der vernünftige Umgang mit Quellen kann so gelehrt und gelernt werden.
(Antworten)
Danke für den tollen Beitrag und die gute Zusammenfassung. ich selbst bin freie Journalistin und zudem Medienpädagogin. Ich vermittele Grundlagen zum Web 2.0, Internet, Sicherheit im Netz, Privatsphäre, Datenschutz, etc… an alle Zielgruppen. Angefangen von Kurzfilm- und Hörspielprojekten an KITAs und in Grundschulen, Internetkurse für Schüler, Eltern und Lehrer. gerade unterrichte ich auch noch Senioren und Schule sie am Computer und zeige ihnen, wie das Netz für den Alltag zu gebrauchen ist.
ich bin der Meinung, dass ein Schulfach denkbar, aber auch ihr Ansatz vollkommen in Ordnung ist. Nur fällt mir eben immer wieder auf, dass es dazu qualifizierte Pädagogen benötigt. Die meisten Eltern und Lehrer kennen sich kaum aus - und können Medienkompetenz kaum weitervermitteln.
ich versuche in Leipzig (und ganz Sachsen) Medienkompetenz in meinen Schulungen, Kursen und Elternabenden und Lehrerfortbildungen zu vermitteln… Vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, vielleicht aber eine Möglichkeit vom Kleinen ins Große zu gehen und mit gutem Beispiel voranzugehen.
(Antworten)
Ich bin selbst noch Schüler und finde ihre Anregungen durchaus beachtenswert und würde mir wünschen, dass viele dieser Ideen umgesetzt werden würden.
Das größte Problem, das ich als Berliner momentan sehe ist, dass die Lehrer zu alt sind. Ein 55 Jähriger erlernt selten noch die Fertigkeiten um genau diese Themen zu vermitteln. Gerade in Berlin ist das ein großes Problem, Beispiel (durch Freunde weiß ich, dieses Beispiel ist relativ repräsentativ): an meiner Schule gibt es keinen “vollwertigen” Lehrer, vollwertig im Sinne eines abeschlossenen Studiums, der unter 40 Jahre alt ist. Die Medienkompetenz des Gros dieser Lehrer ist, um es notentechnisch auszudrücken, bestenfalls mangelhaft. “Frischfleisch” wandert entweder in Bundesländer ab, in denen Lehrer den Beamtenstatus bei Einstellung erreichen oder wird nicht eingestellt.
Zusätzlich fehlt, wie Maria Wagner bereits angemerkt hat, fast immer das Geld und das wird lieber für systemrelevante Banken als für “nachwachsende” Rohstoffe ausgegeben - ich schweife ab, noch ein Grund Medienkompetenz zu fördern.
(Antworten)
Und bis es soweit ist, schummelt man sich mit “erweiteter Texttheorie”, Umdeutung des im Lehrplan geforderten darstellenden Spieles auch auf Hörspiel- und Kurzfilmeinheiten, am PC verfassten Hausaufgaben (als Datei abgegeben), mit elektronischen Mitteln gehaltenen Referaten durch den Unterricht …
Letzter Punkt für Deutsch ist eigentlich schon drin, wenn ich meinen Lehrplan richtig kenne, aber da hat ja auch jedes Bundesland einen anderen (von den unterschiedlichen Schulformen einmal abgesehen).
In der Lehrerausbildung muss sich dazu wirklich viel ändern, kenne zu viele Leute dort, die so technikfern sind … Word wird fast wie eine Schreibmaschine benutzt, PowerPoint klappt nur mit Ach und Krach, Alternativen wie OpenOffice sind nicht bekannt (StudiVZ etc. laufen aber - immerhin etwas), Einbindungen z.B. von Audacity in den Unterricht, Nutzung von RSS-Feeds/YouTube/Wikipedia/… durch Schüler, Bereitstellen von Unterlagen auch im Internet z.B. für Eltern oder kranke Schüler sind hier so ferne Ideen wie der Besuch von Außerirdischen …
(Antworten)
Bei den technikfernen Leuten, die ich meine, handelt es sich übrigens um Leute in den 20ern, keine “alten Typen”, die die Einführung der Technik verpennt haben …
(Antworten)
(@gibro)
1. Zustimmung auf der ganzen Linie. Medienkompetenz - Umgang mit Medien muss als Kulturtechnik verstanden werden, wie lesen, schreiben und rechnen. D.h. sie muss in den bestehenden Fächerkanon integriert werden.
2. Und genau dort liegt auch der Hund beim Jmstv (Jugendmedienschutzstaatsvertrag) begraben. Medienkompetenz soll erst gar nicht erworben werden, es geht eher darum zu schützen, in dem man Inhalte verbirgt, statt sich mit Anderen darüber auseinander zu setzen.
(Antworten)
Die Vorschläge für das Fach Deutsch gehören dort nicht hin. Wie man Texte mit Links anreichert hat doch nichts mit Deutsch zu tun und hängt ja wohl davon ab, wo man den Text veröffentlicht. Alles andere sind Quellenangaben und Fußnoten, das lernt man in guten Schulen auch heute schon, aber nicht speziell im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern.
Und das Bereichern der Texte mit Bildern, Videos etc. macht man wohl dann, wenn man sinnvolle Ergänzungen auch wirklich hat. Viele sollten erstmal lernen, wie man einen guten Text schreibt, ob mit Video oder ohne.
Ihre Vorschläe zur Sozialkunde (bis auf das Urheberrecht) und Kunst sind ebenfalls bei den Fächern falsch angesiedelt.
Zu meiner Schulzeit gab es schon ab der sechsten Klasse sogenannten Rechnerunterricht (heute wäre wohl der Name nicht mehr passend), bei dem wir in zwei oder drei Stunden wöchentlich sowohl die technische als auch gesellschaftliche Seite gelehrt bekamen. Wie bei allem, war es für manche Schüler wie mich nicht viel Neues, für viele aber der Einstieg in den wissenden Umgang mit dem Rechner. Viele Dinge gab es damals(TM), die heute kaum noch von Bedeutung (Newsgroups, IRC,…) sind und anderes gab es noch nicht (Facebook, Twitter,…), aber an sich ist solch ein Brückenfach von den Anfängen der EDV bis zur Privatsphäre im Web 2.0 doch keine schlechte Idee.
Es gibt also schon die richtigen Lehrpläne, die richtige Ausstattung und die richtigen Ideen, nur leider nicht für alle und auch nicht immer zusammen.
(Antworten)
Ach, und um Ihre Frage zu beantworten: Goethe. 2010 und auch 2030. Wir bilden Schüler ja nicht für heute, sondern für morgen. Und ob Google dann noch präsent ist, weiß ich nicht, Goethe bestimmt.
(Antworten)
(@hoebusch)
Deine Anregungen gefallen mir! Auf einen Aspekt möchte ich - auch aus eigener Erfahrung - noch hinweisen: Wenn ich die Vorschläge richtig verstanden habe, zielen diese hauptsächlich auf den Bereich der weiterführenden Schulen (also Mittel- und Realschule sowie Gymnasien). Es ist m.E. nach auch wichtig, den Bereich der Grundschule (wenn nicht sogar den der Vorschule/Kindergarten) miteinzubeziehen. Gerade in den beiden letzten Klassen der Grundschule werden den SchülerInnen auch schon Aufgaben gestellt (z.B. themenbezogene Recherche), die einen medienkompetenten Umgang mit den Quellen (Stichwort: Wikipedia) erfordern.
(Antworten)
(@prothmann)
Guten Tag!
Guckstdu hier:
http://www.blog-cj.de/blog/2010/10/09/ein-buch-das-update-11-die-munchen-connection/comment-page-1/#comment-8761
Habe Dich gerade vorgeschlagen.
Gruß
Hardy Prothmann
(Antworten)
(@maennig)
Na prima, inzwischen hat ja zumindest die baden-württembergische Kultusministerin die Idee schon aufgegriffen und ihre Vorstellungen zur Medienkompetenz-Erziehung in der Schule erläutert. Ich möchte diese Vorschläge jetzt und hier lieber nicht weiter kommentieren.
(Antworten)
(@2011Master)
Ich weiß, das Thema ist aktueller als der Beitrag, aber hier etwas zum Thema Medienkompetenz und Politik:
http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/2010/Sitzungen/20101213/index.jsp
(Antworten)