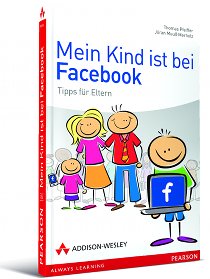Robert Habeck: „Ich nehme die Gegnerschaft an”
Robert Habeck ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/ Die Grünen im Schleswig-Holsteiner Landtag und setzt sich für einen neuen Kurs der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit seiner Partei ein. In seinem 2010 erschienenen Buch »Patriotismus – ein linkes Plädaoyer« entwirft er die Vision von einem „gelingenden Leben” und fordert: „Nicht Volk, Fans”.
Persönlich las ich aus seinem Plädoyer vor allem den einen Kerngedanken heraus: Wenn ich in dieser Gesellschaft zufrieden leben möchte, dann muss ich mich einmischen, dann kann ich nicht über jedes Stöckchen springen, dass man mir hinhält.
Als der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann Anfang der 1970er Jahre auf die Frage, ob er sein Vaterland liebe, mit „Nein. Ich liebe meine Frau.” antwortete, konnte er damit noch irritieren. Aber was ist es dann, was einen dazu bewegt, sich für andere, für die Gesellschaft, in der wir leben, einzusetzen und Anstrengungen darauf zu verwenden, den Seehofers und Westerwellen ein menschliches Politik- und Gesellschaftsverständnis entgegen zu halten? Dazu habe ich Robert Habeck ein paar Fragen gestellt:
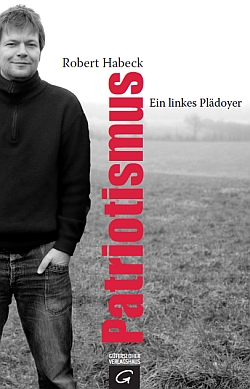
Thomas Pfeiffer: Robert Habeck, Du bist Vorsitzender der Grünen Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein und hast ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Patriotismus – Ein linkes Plädoyer”. Wie weit sind wir von schwarz-grün entfernt?
Robert Habeck: Schwarz-Grün war für mich nie ein Ziel sondern eine Folge. Die Grünen haben sich in den letzten 3 Jahren emanzipiert und verstehen sich nicht als kleiner Koalitionspartner, den man irgendwie einfach einpreisen kann. Das bedeutet, sie entscheiden über Bündnisse und wenn man etwas entscheiden will, dann gibt es Alternativen. Eine solche war schwarz-grün. Es war es, weil die CDU sich in der großen Koalition deutlich modernisiert hatte und in die politische Mitte bewegt hat. Nach der NRW-Wahl hat Merkel entschieden, die Union zurück zu einem Neo-Konservatismus zu führen und die Landesverbände folgen ihr. Ich halte das für eine rein machtstrategische Entscheidung. Erst Greenwashing, nun Greenbashing. Sie kann jederzeit zurückgenommen werden. Aber so lange sie die Grünen als Hauptgegner definiert, nehm ich die Gegnerschaft an.
Gesine Agena, Bundessprecherin der Grünen Jugend, fordert in einem taz-Interview die Abschaffung der Nationalstaaten. Worin unterscheidet sich ein linker Patriotismus vom Nationalismus?
„Auch linke Kräfte müssen die Frage beantworten: Wo geht emotionale Bindung hin?.”
Die „Nation“ ist eine ordnungspolitische Erfindung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Ich teile die Einschätzung, dass wir ganz andere ordnungspolitische Rahmen brauchen als Nationalstaaten. Dann allerdings müssen auch linke Kräfte die Frage beantworten, wo geht emotionale Bindung hin, die es - leider – so eng mit der Nation gegeben hat. Und dass heißt, auch linke politische Kräfte müssen ein identifikatorisches Angebot für Allgemeinwohlorientierung machen.
In einem Interview mit Sandra Maischberger antwortete der Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt auf die Frage: „Kann man sich auf unseren Außenminister verlassen, was seine Führungskraft angeht im europäischen Konzert?“ mit der Gelassenheit eines Elder Statesman: „Ich glaube nicht, dass Sie im Ernst eine Antwort von mir erwarten.” – „So schlimm?” – „Ich hab nichts hinzuzufügen.“. Im politischen Tagesgeschäft wird ansonsten gerne mit härteren Bandagen gekämpft, von allen Seiten. Man beschimpft sich als „Esel” oder „Gurkentruppe” und vergleicht den politischen Gegner mit Hitler oder Goebbels. Wie viel „Show” braucht die Politik und wie viel Ernsthaftigkeit ist man den Bürgerinnen und Bürgern schuldig?
Die „Show“ ist keine aufgesetzte, gewollte oder theoretisch entwickelte Haltung. Sie entstammt der Logik eines strukturell geschlossenen Systems. Das macht es nicht besser. Aber es erklärt, wieso die Bandagen mitunter so hart sind. Politiker müssen sich beweisen. Und da die Entscheidungsspielräume so fürchterlich eng sind, tun sie es über persönliche Attacken. Das ist insofern mit Show falsch benannt. Es ist der Beruf. Und es zeigt seine engen Grenzen.
Der Aufstieg des Internets und des Web 2.0 geht auch einher mit einer Zersplitterung der Gesellschaft. Anhänger und Gegner von Stuttgart 21 führen auf Facebook keinen Dialog *mit*einander, sondern nur *über*einander. Aus ursprünglich drei Bundestagsparteien sind zuerst vier, jetzt sogar fünf geworden. Braucht es nicht aber große Volksparteien, die eine integrative Kraft ausstrahlen und die Gesellschaft einen können, statt sie zu spalten?
„Es braucht Parlamente, die genug Souveränität haben, die besten Konzepte herauszufinden und umzusetzen.”
Nein, die braucht es nicht. Im Gegenteil, im Vergleich mit dem europäischen Ausland ist unsere Parteienlandschaft immer noch eher altmodisch in dem Sinn, dass sie die Identifikation von unterschiedlichen Milieus oder Interessen mit einer kompromisslerischen Linie vorgauckelt. Was es braucht sind Konzepte und Konzeptparteien und Parlamente, die genug Souveränität haben, die besten herauszufinden und umzustezen.
Der Politologe Christoph Bieber fragt sich, ob Parteien klassischer Provenienz nicht ein Auslaufmodell sind. An ihre Stelle treten Themennetzwerke, die sich immer wieder neu zusammenfinden und ohne starre Hierarchien auskommen. Ändert sich die Rolle politischer Parteien dadurch, dass sich die Bürgerinnen und Bürgern zunehmend ohne sie als Vermittler oder Plattform untereinander austauschen und vernetzen können?
Ich beobachte, dass die Bewegungen äußerst instabil sind und im Focus eben auf nur ein Thema konzentriert. Insofern können sie nicht Konzepte anbieten, die irgendwie umfassender sind. Aber die Rolle der Parteien verändert sich ganz sicher. Als Repräsentativorgane werden sie nicht mehr gebraucht. Nur einmal im Jahr mit dem Vorsitzenden eine Currywurst zu essen und ansonsten seinen Mitgliedsbeitrag abzudrücken wird keinem mehr reichen. Es wird eine aktivere Mitgliedschaft werden, eine höhere Fluktuation, und insofern immer ein unmittelbarer Gradmesser, ob eine Partei sich für Interessen der Gemeinschaft einsetzt. Wenn Sie so wollen: Die Parteien werden bürgerlicher im besten Sinn des Wortes. Es werden Bürger-Parteien.
Vielen Dank für das Interview.

 Robert Habeck ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/ Die Grünen im Schleswig-Holsteiner Landtag und setzt sich für einen neuen Kurs der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit seiner Partei ein. In seinem 2010 erschienenen Buch »Patriotismus – ein linkes Plädaoyer« entwirft er die Vision von einem „gelingenden Leben” und fordert: „Nicht Volk, Fans”.
Robert Habeck ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/ Die Grünen im Schleswig-Holsteiner Landtag und setzt sich für einen neuen Kurs der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit seiner Partei ein. In seinem 2010 erschienenen Buch »Patriotismus – ein linkes Plädaoyer« entwirft er die Vision von einem „gelingenden Leben” und fordert: „Nicht Volk, Fans”.