Ausländerfeindlichkeit im situativen Kontext - ein Gedankenexperiment
Am 8. Oktober 2010 gewann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei 3:0. Ein Tor schoss Mezut Özil, Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Sein Spiel wurde 90 Minuten lang von den Berliner Fans ausgepfiffen, hauptsächlich von Anhängern der türkischen Mannschaft. Denen wurde daraufhin mangelnde Integrationsbereitschaft nachgesagt. Mir reicht solch ein Pfeifkonzert allerdings als Beleg für eine sog. „Integrationsverweigerung” (welch dummer Begriff!) nicht aus.
Ein Gedankenexperiment:
Nehmen wir an, jeder Mensch hat einen gewissen Punkt, an dem er (oder sie) in ein Pfeifkonzert einstimmt. Nehmen wir weiterhin an, diesen Punkt kann man auf einer ordinalskalierten Skala zwischen - sagen wir - eins und 100 bestimmen. Null bedeutet hierbei, die Person pfeift immer vor sich hin und 100 heißt: da pfeift niemals jemand. Die angreisten Fan-Trommler liegen vielleicht bei zehn, Angela Merkel in der VIP-Lounge bei 95.
Wenn das Erregungspotenzial einer Person über den individuellen Schwellenwert ansteigt, beginnt die Person mit dem Pfeifen. Dieses individuelle Erregungspotenzial ist abhängig von einer Reihe von Faktoren:
- kann man pfeifen und tut man das grundsätzlich gerne
- ist man angetrunken
- mag man Mezut Özil als Mensch oder zumindest als Fussballspieler
- ist man gut gelaunt oder nicht
- verstehet man Pfeifen als Ausdruck der Freude
- hat Mezut Özil ein Foul begangen oder spielt er an diesem Tag nicht so, wie man sich das wünscht
- pfeifen die Anderen um einen herum
- und vieles andere mehr
Interessant ist der vorletze Punkt: „Pfeifen die Anderen um einen herum”: Je mehr pfeifen, desto eher wird man einstimmen, unabhängig von den anderen oben aufgezählten intrapersonellen Faktoren wie Integrationsbereitschaft, Identifikation mit Deutschland, dem eigenen Alkoholspiegel und ob man pfeifen kann oder nicht.
Nehmen wir an, der Schwellenwert, mit dem Pfeifen zu beginnen, ist in der Gruppe unterschiedlich verteilt, vielleicht normalverteilt, mit wenigen Personen an den Rändern (mit den Werten null bis 20 und 80 bis 100) und vielen in der Mitte um die 50. Auch eine Power Law-Verteilung ist denkbar, ist aber letztlich für dieses Gedankenexperiment nicht entscheidend.
Fall A:
Im Stadion stehen also vielleicht gar nicht so viele Rassisten herum (das nehme ich für das Experiment zunächst an), sondern nur Wenige haben die Bereitschaft zu pfeifen (deren Schwelle liegt sehr niedrig). Die pfeifen vor sich hin und erhöhen damit das Erregungspotenzial der Anderen im Stadion. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf („Teufelskreis”) beginnt, es pfeifen immer mehr und es kommt nach kurzer Zeit zu einem Pfeifkonzert.
Fall B:
Im Stadion sind die fast gleichen Leute und schauen Fußball. Nur einige mit besonders geringem Schwellenwert fehlen. Was passiert? Kein Pfeifkonzert, niemand nimmt die Finger in den Mund und trällert eine Melodie, weil keiner mit seinem individuellen Erregungspotenzial über seinen eigenen Schwellenwert kommt.
Conclusio
Spannend ist der Unterschied zwischen beiden Fällen. Der Großteil der Personen ist gleich geblieben, ihre individuellen Wertvorstellungen, ihre Charaktere, ihre Eigenschaften, kurz: alles an diesen Personen ist in beiden Fällen gleich. Nur im Fall A wird von einer mob-artigen Masse gesprochen, die ein Pfeifkonzert veranstaltet, in Fall B passiert nichts, obwohl der Großteil der Menschen diesselben sind.
Ich weiß nicht, welche Menschen am 8. Oktober im Berliner Olympiastadion gepfiffen haben, aber nur aufgrund der Tatsache, dass ein Pfeifkonzert stattgefunden hat, kann man recht wenig über deren Motive sagen.
Ich denke, wir überschätzen zu oft die Charaktereigenschaften von Menschen bei der Erklärung ihres Verhaltens und wir unterschätzen systematisch auf der anderen Seite situative Einflüsse, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten veranlassen.
(Ich entlehne dieses Gedankenexperiment aus Malcom Gladwells Buch »Tipping Point«)



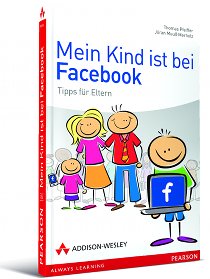


(@kadekmedien)
»…nur aufgrund der Tatsache, dass ein Pfeifkonzert stattgefunden hat, kann man recht wenig über deren Motive sagen.«
Das stimmt natürlich. – Es sein denn, »man« möchte etwas darüber sagen. Dann bietet sich so ein Pfeifkonzert ja geradezu an, an den Haaren herbeigezogen zu werden.
Schönes Gedankenexperiment!
(Antworten)
(@alsoeigentlich)
Das halte ich für gutdenken, aber nicht für realistisch. Fußballfans wissen schon ganz genau, wann sie pfeiffen oder schreien und warum sie das tun. Die allerwenigsten Fußballfans lassen sich von Stimmungen anstecken, sondern sind sich meistens ziemlich einig in der Tatsache warum jemand oder eine Situation ausgebuht, -gepfiffen, angefeuert oder sonst was sollte. Das beobachte ich regelmäßig in meinem Block.
Ich würde natürlich auch nicht gleich von einem Pfeiffkonzert darauf schließen, dass die türkischstämmigen Besucher integrationsunwillig sind, gleichwohl ich mir extrem sicher bin, dass sie sehr wohl und in der Mehrheit es fürchterlich fanden, dass Mesut für die Deutschen aufläuft und nicht für ihre Mannschaft. Das zu werten ist eine andere Geschichte, aber das es so war, da bin ich mir doch sehr sicher.
(Antworten)
@alsoeigentlich Wie gesagt, mir reicht ein „da bin ich mir doch sehr sicher” nicht aus. Das ist nicht gut-denken, sondern dumm-denken, was Sie da fabrizieren.
(Antworten)
Ich provoziere mal einwenig:
“Ich weiß nicht, welche Menschen am XX.XX.2010 im Leipziger Stadion den rechten Arm zum Gruß erhoben haben, aber nur aufgrund der Tatsache, dass eine Vielzahl an Zuschauern den Arm zum Gruß erhoben haben, kann man recht wenig über deren Motive sagen.”
Bitte verstehe mich nicht falsch, ich will hier nichts gleichsetzen, denn natürlich hinkt mein Beispiel (oder vielleicht doch nicht?) Aber ich denke dennoch, dass es Deines Erklärungsversuches nicht bedarf. Natürlich kann es sein, dass nur viele Mitläufer im Stadion waren, die leicht anzustecken waren. Vielleicht war es aber auch anders….
(Selbstverständlich kann es einfach nur damit zusammenhängen, dass Özil als Deutscher mit türkischen Wurzeln jetzt für den sportlichen Gegner spielt. Nichts anderes würde ihm passieren, wenn er als Ex-Dortmunder nun für Schalke auflaufen würde… )
Das Phänomen, dass man auf äußere Umstände und Situationen attribuiert, wenn Dinge schief laufen; aber auf interpersonale Faktoren, wenn etwas gut verläuft, ist auch ein seit langem bekanntes Phänomen in der Sozialpsychologie. -> Pfeife ich einen Menschen aus, mache ich das, weil die Situation Schuld war und alle es getan haben. Jubel ich jemandem zu, dann weil ich eine liberale Einstellung besitze…
(Antworten)